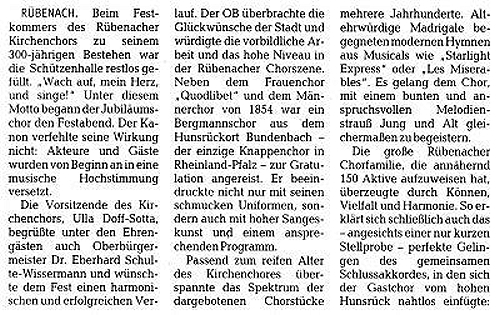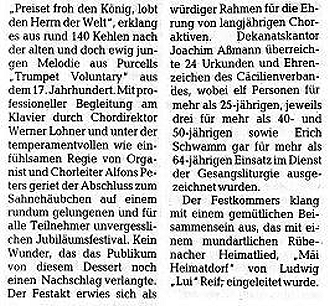Land & Leute
 „Fasziniert hat mich der Gedanke Pallottis zur umfassenden Berufung“, erklärt Rainer Autsch. Im Herbst 2002 trat der 23–jährige Koblenzer in das Noviziat der Gemeinschaft ein. „Meine Familie und meine Freunde waren damals über meine Entscheidung ziemlich überrascht“, erklärt Autsch. Heute haben sie die Entscheidung akzeptiert. Bereits als kleiner Junge spürte Rainer Autsch den Wunsch, einmal Priester zu werden.
„Fasziniert hat mich der Gedanke Pallottis zur umfassenden Berufung“, erklärt Rainer Autsch. Im Herbst 2002 trat der 23–jährige Koblenzer in das Noviziat der Gemeinschaft ein. „Meine Familie und meine Freunde waren damals über meine Entscheidung ziemlich überrascht“, erklärt Autsch. Heute haben sie die Entscheidung akzeptiert. Bereits als kleiner Junge spürte Rainer Autsch den Wunsch, einmal Priester zu werden.
Er engagierte sich in der Jugend– und Messdienerarbeit seiner Heimatpfarrei St. Mauritius in Rübenach. Nach dem Realschulabschluss wechselte Autsch auf das Gymnasium auf der Karthause: „Damals war ich noch Leistungssportler im Koblenzer Ruderclub Rhenania“, erklärt Autsch lächelnd. 2002 machte er sein Abitur. „Ich stand nun vor der Frage, wie es weitergeht, und was ich für mein Leben möchte“, erinnert sich Autsch. Der Sport machte ihm weiterhin viel Freude, doch das Interesse an den Pallottinern und die innere Gewissheit, Priester werden zu wollen, wurden größer. Im Oktober 2004 legte er seine erste zeitliche Profess ab und band sich so an die Gemeinschaft. Seitdem studiert er an der philosophisch–theologischen Hochschule der Pallottiner in Vallendar. (sts)
Rhein Zeitung – 31.08.2005